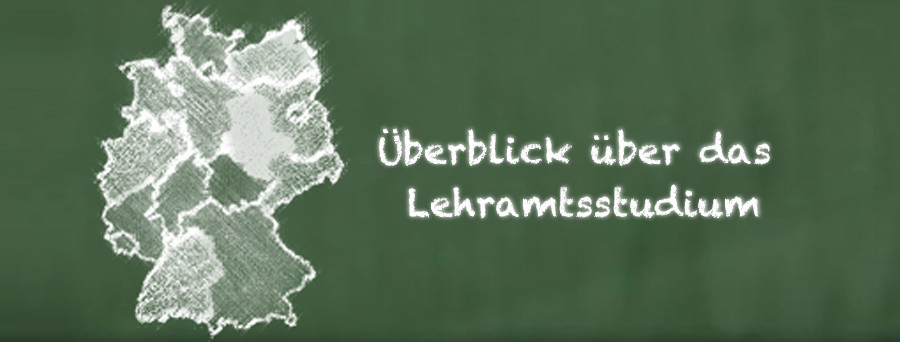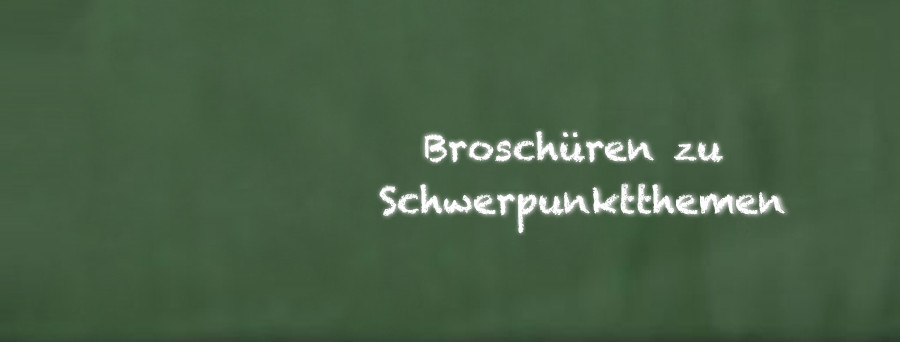15. April 2024
April-Newsletter erschienen: Lehrkräftebildung im Wandel
Nachdem die KMK Mitte März
Beschlüsse zur Lehrkräftebildung gefasst hatte, gab es eine Vielzahl an Reaktionen – teils zustimmend, teils ablehnend. Die (aus unserer Sicht) wichtigsten haben wir in dieser Newsletter-Ausgabe für Sie zusammengefasst . Am meisten polarisiert der Entschluss, duale Lehramtsstudiengänge einzurichten.
Die Meldungen aus den Ländern und auch aus unserem Nachbarland Österreich der vergangenen Wochen zeigen eindrücklich, dass man sich allerorten mit Ideen und Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel auseinandersetzt – und zwar fachbezogen (z.B. im Fach Musik oder in den MINT-Fächern), regional (Lehrkräftemangel auf dem Land) und schulformbezogen (Lehrkräftemangel an Berufsschulen). Vor dem Hintergrund der KMK-Beschlüsse werden nun in jedem Land Reformmodelle diskutiert, die den jeweiligen Bedarfen vor Ort am besten Rechnung tragen.
Eine Premiere gibt es auch noch zu vermelden: Die Universitäten Tübingen und Stuttgart und die PH Ludwigsburg haben mit Förderung des Wissenschaftsministeriums gemeinsam das bundesweit erste Postdoc-Kolleg für Nachwuchswissenschaftler*innen mit Lehramtshintergrund eingerichtet. In den kommenden sechs Jahren richtet es den Blick auf Bildung und KI im 21. Jahrhundert.
Wir wünschen allen Leser*innen viel Spaß beim Lesen und freuen uns, wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen.
Zum kompletten Newsletter
15. März 2024
März-Newsletter erschienen: Kultusministerkonferenz mit Beschluss zur Lehrkräftebildung
Gestern und heute tagte die Kultusministerkonferenz und beriet sich unter anderem zu den Vorschlägen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zur Lehrkräftebildung, die diese im Dezember in einem ausführlichen
Gutachten vorgelegt hat. Im Vorfeld der KMK kursierten Warnungen und Empfehlungen von Verbänden, Gewerkschaften und Bildungswissenschaftler*innen. Im Mittelpunkt der Debatte standen häufig Überlegungen für oder gegen die Einführung dualer Lehramtsstudiengänge. So kann sich die
GEW gut vorstellen, lehramtsbezogene Masterstudiengänge dual zu gestalten, um eine bessere Theorie-Praxis-Verzahnung zu ermöglichen. Klar gegen duale Modelle und eine Vermischung der zwei Phasen sprechen sich hingegen
die im dbb organisierten Lehrerverbände wie der Deutsche Philologenverband aus. Die Bildungsforscherin und SWK-Co-Vorsitzende Felicitas Thiel warnte im Blog des Bildungsjournalisten
Jan-Martin Wiarda vor einer De-Professionalisierung durch duale Lehramtsstudiengänge und rät, wie schon im Gutachten selbst, von der Einführung solcher Studiengänge ab. Nun haben die Kultusminister*innen heute tatsächlich bekanntgegeben, neben anderen strukturellen Neuerungen wie Quereinstiegsmasterstudiengängen und Qualifizierungswege für Ein-Fach-Lehrkräfte den Weg für die Einrichtung dualer Lehramtsstudiengänge auf KMK-Ebene zu ebnen (
KMK).
Das Deutsche Schulportal hat in einem Überblick zusammengestellt, wo Modelle dualer Lehramtsstudiengänge zurzeit in Planung sind und wie sie aussehen.
Außerdem lohnt sich ein Blick in die Rubrik „Interviews und Kommentare“ wo zwei sehr hörenswerte Podcast-Folgen aufs Anhören warten und Axel Gehrmann, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung der TU Dresden, im Interview mit dem Deutschen Schulportal interessante Einblicke in Learnings aus der Seiteneinstiegsqualifizierung in Sachsen gibt.
Zum kompletten Newsletter
16. Februar 2024
Februar-Newsletter: CHE und Stifterverband suchen Verstärkung im Themenfeld Lehrkräftebildung
Viel ist in Bewegung in der bildungspolitischen Diskussion rund um die Lehrkräftebildung. Wer Lust hat, sich beruflich oder neben dem Studium in diesem Feld einzubringen, dem seien gleich zu Beginn zwei interessante Stellenangebote ans Herz gelegt:
Stifterverband sucht Verstärkung im Bereich Lehrkräftebildung
Der Stifterverband sucht am Standort Essen ab dem 01. April 2024 einen Programmmanager (m/w/d) für die Begleitung und Unterstützung der „Allianz für Lehrkräfte“. Ziel dieser Allianz ist es, mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern und die Ausbildung so attraktiv zu gestalten, dass mehr Menschen den Ausbildungsweg auch bis zu Ende gehen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wichtige Zukunftskompetenzen und digitales Know-how – vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz – in den Schul- und Studienfächern eine größere Rolle spielen.
Nähere Infos zur Stellenausschreibung gibt es
hier.
CHE sucht Werkstudent*in (m/w/d) mit 15 Std./Woche für den Monitor Lehrerbildung
Wir suchen für den Monitor Lehrerbildung studentische Verstärkung ab dem 01. März 2024 und freuen uns über Bewerbungen. Die Stelle umfasst sowohl Tätigkeiten im Bereich der Projektkommunikation (unter anderem Mitarbeit an diesem Newsletter) als auch im Bereich Datenbereinigung und Datenanalyse. Es winken vielfältige Einblicke in unsere spannende Projektarbeit.
Nähere Infos zur ausgeschriebenen Stelle gibt es
hier.
Alles, was in den vergangenen vier Wochen rund um die Lehrkräftebildung wichtig war, finden Sie wie immer in unserem Newsletter.
Zum kompletten Newsletter
13. Februar 2024
Stellenausschreibung: Stifterverband sucht Verstärkung im Bereich Lehrkräftebildung
Der Stifterverband sucht am Standort Essen ab dem 01. April 2024 einen Programmmanager (m/w/d) für die Begleitung und Unterstützung der „Allianz für Lehrkräfte“. Ziel dieser Allianz ist es, mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern und die Ausbildung so attraktiv zu gestalten, dass mehr Menschen den Ausbildungsweg auch bis zu Ende gehen, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wichtige Zukunftskompetenzen und digitales Know-how – vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz – in den Schul- und Studienfächern eine größere Rolle spielen.
Nähere Infos zur Stellenausschreibung gibt es hier.
17. Januar 2024
Januar-Newsletter: Willkommen in 2024 – einem Jahr der Lehrkräftebildung?!
Wir begrüßen Sie - ein wenig später als üblich – im neuen Jahr 2024!
Mit dem Anfang Dezember vorgelegten neuen Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK (SWK) und den darin enthaltenen Vorschlägen für eine bessere Lehrkräftebildung und Lehrkräftegewinnung liegt eine Art Arbeitsprogramm vor, das uns und vor allem die neue KMK-Präsidentin, Christine Streichert-Clivot aus dem Saarland, in diesem Jahr weiterhin beschäftigen wird. Reaktionen auf das Gutachten fassen wir in diesem Newsletter noch einmal prominent zusammen.
Außerdem in dieser Ausgabe: Der Lehrkräftemangel hält an und die Zahl der Studienanfänger*innen, die ein Lehramtsstudium aufnehmen, ist laut neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes erneut rückläufig. Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe hat eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass eine von fünf angehenden Lehrkräften nach dem Lehramtsstudium (zunächst) nicht ins Referendariat übergeht. In Bayern und Berlin spricht man über konkrete Reformen des Lehramtsstudiums und an der Uni Magdeburg gibt es nun die erste Universitätsschule in Sachsen-Anhalt.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir suchen für den Monitor Lehrerbildung zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich Datenerhebung und Datenanalyse! Kommen Sie in unser kleines Team und begleiten Sie mit uns die Entwicklungen in der Lehrkräftebildung in den kommenden beiden Jahren kritisch-konstruktiv. Wir freuen uns über Bewerbungen!
Zum kompletten Newsletter
8. Dezember 2023
Dezember Newsletter: Lehrkräftebildung im Spotlight
Alle reden über Lehrkräftebildung. Im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen
Gutachtens der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK (SWK) zur Lehrkräftebildung, die heute Mittag stattfand, war das Thema Lehrkräftebildung medial so präsent wie selten zuvor. Und so zeigt auch diese Jahresend-Ausgabe unseres Newsletters eine Bandbreite an Vorschlägen, Empfehlungen und Kontroversen unterschiedlicher Akteure, wie die Lehrkräftebildung reformiert werden könnte – darunter der Stifterverband, der insgesamt 75 Maßnahmen in einem
Masterplan zusammengestellt hat. Außerdem nimmt die Arbeit des Kompetenzverbundes lernen:digital Fahrt auf (
Deutsches Schulportal), während die Qualitätsoffensive Lehrerbildung zum Jahresende endgültig ausläuft. Im letzten
Newsletter der QLB finden sich prominente Bilanzierungen der Errungenschaften des nun endenden Förderprogramms.
Auch die Veröffentlichung der neuen PISA-Ergebnisse und insbesondere das schlechte Abschneiden deutscher Schüler*innen in Mathematik entfachte Diskussionen über die Lehrkräftebildung und den Lehrkräftemangel – insbesondere mit Blick auf die Basiskompetenzen (Tagesspiegel).
Auch aus den Hochschulen gab es im vergangenen Monat viele spannende und teils erfrischende News zur Lehrkräftebildung – von einem weiteren Vorstoß beim dualen Lehramtsstudium an der Uni Erfurt (MDR) bis zu einem einzigartigen Studienangebot für das Fach Plattdeutsch an der Uni Oldenburg (News4teachers).
Wir wünschen allen Leser*innen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen schönen Jahresausklang.
Zum kompletten Newsletter
3. November 2023
November-Newsletter erschienen
Duale Studienmodelle im Lehramt
Angesichts des anhaltenden Lehrkräftemangels entstehen an den Hochschulen neue Lehramtsstudiengänge, die zum Teil ganz neue Wege einschlagen. An der BTU Cottbus-Senftenberg sorgt ein neuer Grundschullehramtsstudiengang für viel Aufmerksamkeit – das Besondere: Die Studierenden sind ab dem ersten Semester regelmäßig an Schulen und das Masterstudium soll dual sein. Für dieses neuartige Modell vergab der Stifterverband die Hochschulperle des Monats Oktober. Auch in Baden-Württemberg werden erste duale Masterstudiengänge im Lehramt eingerichtet – an der PH Karlsruhe, der Universität Stuttgart und der Universität Freiburg sollen zum Wintersemester 2024/25 zunächst 60 Studierende nach dem neuen Modell studieren, wie tagesschau.de berichtete.
Auch inhaltlich tut sich etwas im Lehramtsstudium: An der TU Dresden gibt es nun ein verpflichtendes Modul zur politischen Bildung für alle Lehramtsstudierenden, an den Universitäten in Kiel und Flensburg hat ein nun beendetes QLB-Projekt zur Verankerung digitaler Kompetenzen im Lehramtsstudium geführt, an der Universität Eichstätt-Ingolstadt wird an Basiskompetenzen zur Inklusion gearbeitet und in Marburg sollen Querschnittsthemen des Lehramtsstudiums in einem innovativen Teaching Lab gebündelt werden.
Zum kompletten Newsletter
6. Oktober 2023
Oktober-Newsletter erschienen
Mehr Schüler*innen, weniger Lehramtsabsolvent*innen, mehr Quereinsteiger*innen
Den Auftakt der Oktober-Ausgabe unseres Newsletters bilden jede Menge Zahlen mit Implikationen für die Lehrkräftebildung. Das Statistische Bundesamt stellt fest, dass die Zahl der Lehramtsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist – um 3 Prozent. Im Zehn-Jahres-Zeitraum lässt sich jedoch ein größerer Rückgang beobachten: Um ganze 10,5 Prozent ist die Zahl der Lehramtsabsolvent*innen in diesem Zeitraum gesunken. Außerdem ist der Anteil der Quer- und Seiteneinsteiger*innen ohne Lehramtsstudium im gleichen Zeitraum von 5,9 auf 8,6 Prozent gestiegen. Die Kultusministerkonferenz hat im September neue Schülerzahlen vorgelegt, die die Grundlage für die Lehrkräftebedarfsprognose bilden: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler liegt um 300.000 höher als im Vorjahr prognostiziert. Den höchsten Anstieg erwartet die KMK an den Schulen der Sekundarstufe I, jedoch auch weiterhin an Grundschulen und Berufsschulen. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat bei den Kultusministerien erfragt, wie viele Lehrkräfte derzeit bereits fehlen: mehr 14.000 in ganz Deutschland, besonders viele in Nordrhein-Westfalen.
Vor diesem Hintergrund rückt auch die Lehrkräftebildung mit besonderen Fragestellungen in den Fokus. Heute ist in Berlin der Abschlusskongress der Qualitätsoffensive Lehrerbildung zu Ende gegangen. Eine Fortsetzung des Bund-Länder-Programms soll es nicht geben. Dennoch sprechen sich Gewerkschaften für ein Nachfolgeprogramm aus, denn „nie war die Lehrkräftebildung wichtiger als heute“, so Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender und Hochschulexperte der GEW (News4teachers).
Und auch von den Partnern des Monitor Lehrerbildung gibt es interessante Neuigkeiten: Was die Parteien in Bayern planen, gegen den Lehrkräftemangel zu unternehmen, hat der Stifterverband kurz vor der Landtagswahl in Wahlprüfsteinen zusammengetragen, die Robert Bosch Stiftung hat im Deutschen Schulbarometer Lehrkräfte zu aktuellen Herausforderungen erfragt – so fühlen sich etwa nur wenige durch ihr Studium auf Inklusion vorbereitet. Und Bertelsmann Stiftung hat in einem Impulspapier Empfehlungen an die Kultusminister*innen zusammengetragen, wie das Potenzial ausländischer Lehrkräfte besser genutzt werden kann.
Zum kompletten Newsletter
8. September 2023
September Newsletter erschienen
Reformvorhaben und Maßnahmenpakete für mehr Lehrkräftenachwuchs
In vielen Bundesländern gingen in den vergangenen Wochen die Sommerferien zu Ende. Entsprechend überwiegen in dieser Ausgabe unseres Newsletters Meldungen aus den Ländern zum Lehrkräftemangel zu Schuljahresbeginn. Viele Reformvorhaben und Maßnahmenpakete werden derzeit von den Ländern auf den Weg gebracht, um auch langfristig für mehr Lehrkräftenachwuchs zu sorgen. Viele Maßnahmen setzen dabei schon beim Lehramtsstudium an:
In Berlin schreiben die neuen Hochschulverträge eine neue Zielzahl an Lehramtsabsolvent*innen fest (Tagesspiegel) und eine neu eingesetzte Expert*innenkommission soll sich mit dem Personalmangel an Grundschulen befassen (Tagesspiegel). In Brandenburg wurden die Stipendienplätze für das Landlehrerstipendium erhöht, das Lehramtsstudierende für den Schuldienst im ländlichen Raum gewinnen soll (Deutschlandfunk). Im Saarland hat Bildungsministerin Streichert-Clivot einen Fünf-Punkte-Plan zur Lehrkräftegewinnung vorgestellt, der eine praxisnähere Ausbildung und Ausbildungsschulen vorsieht (News4teachers) und in Sachsen soll ein neues Bildungspaket für das Lehramt Schwundquoten senken und Studienplatzkapazitäten besser auslasten (Leipziger Volkszeitung).
Außerdem lohnt es sich, bis ganz nach unten zu scrollen. Unter „Sonstiges“ wartet ein interessanter TV-Beitrag, der der Frage nachgeht, was eigentlich aus dem Traumberuf Lehrer*in geworden ist.
11. August 2023
August Newsletter erschienen
Strukturelle Reformen der Lehrkräftebildung im Fokus
Noch bevor die meisten Bundesländer in die Sommerferien gingen, veröffentlichte der Wissenschaftsrat Mitte Juli ein Gutachten zur Lehrkräftebildung im Fach Mathematik, das auch Signalwirkung für die gesamte Lehrkräftebildung haben dürfte. Es enthält umfangreiche Empfehlungen, wie eine stärkere Professionsorientierung, eine engere Kooperation zwischen Schulen und Hochschulen, eine Stärkung der Zentren für Lehrkräftebildung oder eine Integration des Referendariates in das Lehramtsstudium im Sinne eines dualen Studiums.
Die ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Dorothea Wagner, erläutert zentrale Empfehlungen des Gutachtens in einem ausführlichen Interview beim Deutschen Schulportal. Laut der Mathematikerin Wagner seien Kompetenzzentren eine gute Lösung, um Studierende während des Studiums angemessen zu fördern und zu beraten. Insgesamt müsse die Angst vor dem Studiengang Mathematik genommen werden und eine Professionsorientierung für das Lehramt müsse im Studium bereits frühzeitig erfolgen.
Die Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) äußerte sich unterdessen in einer Stellungnahme zu alternativen Qualifikationswegen im Lehramt und fordert, dass alternative Qualifikationswege in Zusammenarbeit mit Hochschulen erfolgen.
In Baden-Württemberg wurde nicht nur die Einführung erster dualer Lehramtsstudiengänge bekanntgegeben, sondern auch eine wissenschaftliche Studie zu Erfolgs- und Abbruchquoten im Lehramtsstudium veröffentlicht.
Trotz Sommerloch gibt es also für alle Interessierten an Strukturdebatten im Lehramt jede Menge Lektüre! Wie immer enthält unser Newsletter alle wichtigen Meldungen der vergangenen Wochen.